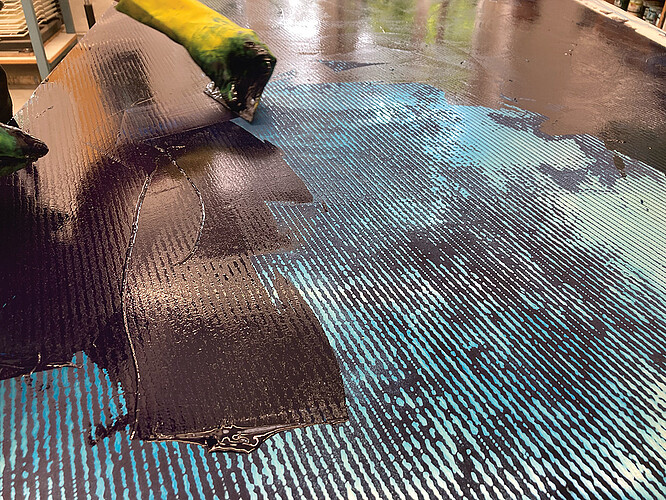In der Werkstatt für experimentelle Druckgrafik
An den Wänden der Werkstatt links und rechts der hellen Fensterfront
zum Ruinengarten hängen großformatige Drucke. Kaum freier Platz.
Wir sprechen, während Lisa, Ronja und Lilith arbeiten und Katja, die
Werkstattleiterin, gelegentlich mit aufmerksamem Blick einen vorsichtigen
Rat gibt oder selbst mit anpackt. Die Arbeitsatmosphäre in
der Werkstatt ist energetisch, konzentriert und zugleich sehr offen.
Katja: Das ist total wichtig. Dass man seine Arbeiten hier frei entwickeln
kann. Man hängt hier Sachen, die nicht fertig sind – man gibt da
sehr viel von sich preis und ist immer gleich öffentlich. Also muss man
für einen Raum sorgen, der ein Labor ist: Hier wird nicht ausgestellt,
sondern man ist im Prozess. Die Drucke links an den Wänden sind
Lisas neueste Arbeiten. Es sind Hochdrucke kombiniert mit Tiefdruck,
auf Papier und auf Seide. In verschiedenen Stadien der Druckplatte
und mit unterschiedlichen Farben. Sie hat wasserlösliche Farben verwendet,
die relativ schnell trocknen. Ölfarben oder Drucke mit mehreren
Farbschichten brauchen zwei, drei Wochen, wie die von Lilith
gegenüber.
Neben uns liegen 2 m große Blätter feuchtes Büttenpapier. Sie wurden
über Nacht gewässert und sind nun bereit.
Katja: Lilith reibt gerade ihre Zinkplatte aus, die wir gleich drucken
wollen. Und Ronja mischt die sojabasierten Farben auf den Farbsteinen
für ihren neuen Druck von Tetrapak. Beides werden Tiefdrucke
und dafür benutzen wir Bütten.
Und schon sind wir mitten drin: Was ist Experimentelle Druckgrafik?
Katja: Ich fange mit der Frage an, was ist Hochdruck, was ist Tiefdruck?
Beim Hochdruck werden die hoch liegenden Stellen des Druckstocks
gedruckt, dazu gehören Holzschnitt, Linolschnitt. Die Drucke
können mit der Druckpresse oder mit der Hand „abgerieben“ werden.
Der Tiefdruck – dazu gehören Radierung und Kupferstich – ist genau
das Gegenstück zum Relief, da werden die tief liegenden Stellen gedruckt.
Klassisches Material sind Kupfer- oder Zinkplatten. Die Farbe
führen Höhen und Tiefen, auch eine Rasterung.
… so wie auf Liliths Platte …
Katja: Ja, die Farbe wird mit Spachtel oder Walze aufgetragen. Es
ist gut, die Metallplatten vor dem Drucken etwas zu wärmen. Die
Ölfarbe geht dann besser in die Vertiefungen, weil sie flüssiger ist.
Gerade wenn Lilith wie hier mit Carborundum arbeitet und große gerasterte
Flächen hat, muss überall genug Farbe hinein. Die überschüssige
Farbe reibt man dann mit Gaze aus, mit kreisenden Bewegungen,
ohne zu scheuern. Für mich ist die Platte auszureiben die schönste Arbeit
– eine sehr kontemplative Tätigkeit. Und sich darauf zu freuen,
wenn dein Motiv dir wieder entgegenkommt.
Das Experimentelle ist also bei jedem Element, jeder Phase, jeder
Technik.
Katja: Es ist wichtig, dass man versteht, wie das druckgrafische Denken
und die Techniken funktionieren, um sich dann ins Experiment
zu begeben und sich aus diesem Repertoire zu bedienen. Fragen zu
stellen, in Analogien zu denken, neu zu verknüpfen, in andere Materialien
zu transferieren, in andere Werkzeuge, andere Dimensionen.
Lisa kombiniert beide Verfahren, hat zuerst einen Tiefdruck gemacht
und danach mit derselben Platte im Hochdruck darauf gedruckt, auch
auf Seide.
Katja: Ja, die feuchten Tiefdrucke liegen zunächst in Trockenpappen
und werden mehrmals umgestapelt, damit die Drucke sich nicht wellen.
Das kann einige Tage dauern. Danach druckt Lisa ihren Holzschnitt
über den Tiefdruck. Oft sind es mehrere Schichten und verschiedene
Zustände der Platte. Bei dieser kombinierten Arbeitsweise müssen einige
Besonderheiten beim Material und auch beim Schneiden mitgedacht
werden, z. B. dass das Papier mit dem Tiefdruck schrumpft und
die Platte im Hochdruck größer wirkt. Auf Seide zu drucken, war wiederum
eine Idee von Ronja.
Lilith, deine Platte ist 2 m lang, das Ausreiben der Farbe ist geradezu
bildhauerisch …
Lilith: … weil es sehr manuell ist. Und auch die Arbeit wird skulptural:
Ich werde sie in ein Metallgestell einspannen und als ein gebogenes
Panorama zeigen. Ich glaube, in der Grafik ist sehr viel von anderen
Medien und Techniken. („Der Sturm“ ist auf S. 4-5 zu sehen.)
Wie hast du hier gearbeitet?
Lilith: Zuerst im Siebdruck. Wir haben leider keine Werkstatt für Fotoradierung
mehr, und da ich gern mit Fotografie arbeiten wollte, sind
Katja und ich auf eine Carborundumpaste gekommen. Die Vorlage ist
ein Siebdruck von einer digitalisierten Zeichnung von mir auf einer
Tiefdruckplatte. Die Farbe reibt man ein, wie beim klassischen Tiefdruck.
Das Schöne ist, man sieht noch das Punktraster nach dem Siebdruck.
Die Ästhetik ist aber anders und die Ergebnisse haben tiefere
Schwärzen und starke Kontraste. Sie erinnern an Fotoradierungen,
sind äußerst präzise und detailreich. Ich habe das Tiefdruckverfahren
durch Siebdruck erweitert – man kann eben Techniken miteinander
verbinden und daraus etwas Neues entwickeln.
Vor uns mitten im Raum steht die riesige Druckpresse. Sie kann beides,
Hochdruck und Tiefdruck.
Katja: Diese Radierpresse kann 2 m Werkformate drucken. Beim Tiefdruck
druckt man mit drei Druckfilzen, sie vermitteln den enormen
Druck auf die Druckplatte und das zu bedruckende Büttenpapier.
Eingestellt wird der entsprechende Druck manuell an den beiden
Druckspindeln rechts und links an der Maschine. Das ist in beiden Verfahren
entscheidend und erfordert Erfahrung. Beim Hochdruck können
die Druckstöcke sehr unterschiedliche Höhen haben. Die Oberwalze
wird deshalb seitlich des Druckstocks mit Leistensystemen
unterfüttert und druckt „nur“ mit ihrem Eigengewicht, was schon 900
kg sind. Die Presse selbst wiegt etwa 2,5 Tonnen. Sie ist etwas sehr
Besonderes hier an der UdK. 1994 wurde sie angeschafft, da war ich
noch Studentin und habe mit Jim Dine hier zum ersten Mal experimentell
gearbeitet …
… der berühmte amerikanische Pop-Art-Künstler war für ein Jahr an
der HdK in Berlin.
Katja: Ich habe mit Holzschnitten angefangen, weil ich in einem Haushalt
aufgewachsen bin, wo Holz und Werkzeug immer herumlag.
Mich hat Zeichnung interessiert, schwarz/weiß, hell/dunkel, das Verändern
von Linie und Fläche in verschiedenen Materialauseinandersetzungen,
später die klassische Radierung und der experimentelle
Tiefdruck. Und dann kam diese große Presse, unfassbar, dieses Format
... Und dabei bin ich geblieben.
Eine solche Dimension fordert auch ein anderes Denken.
Katja: Für mich ist es spannend, die traditionellen Techniken in diesem
Format zu erweitern, zu schauen, was sich verändert, was passiert mit
den Details, den Oberflächenstrukturen, welche Materialien funktionieren,
was kann man kombinieren, was kann man drucken und wie.
Ich probiere selbst immer wieder Neues aus. Zuletzt haben mich Collagrafien
interessiert, dort ist die Druckplatte selbst eine Collage. Das
heißt, collagiert werden unterschiedliche Materialien, die Höhenunterschiede
im Minimalbereich haben, geprägtes Papier z. B., und im
Tiefdruck gedruckt. Beim Hochdruck ist das Format eigentlich unbegrenzt,
und eine Maschine braucht man ja nicht unbedingt, man kann
auch ganze Linol-Fußböden von Hand abreiben.
Was hat sich über die Jahre hier verändert oder ist stabil geblieben?
Oder ist das eher von individuellen Interessen bestimmt? Trends?
Katja: Es ist sehr individuell, aber ein Trend ist die Neugier auf Alternativen.
Neugier auf Möglichkeiten non-toxisch zu arbeiten, sowohl
bei der Bearbeitung und Herstellung der Druckplatten als auch bei
der Wahl der Druckfarben. Alternativen werden auch bei den Materialien
gesucht, beim Holzschnitt kommen oft Bretter zum Einsatz, die
wiederverwendet werden, Fundstücke … Ich finde es wichtig, zu signalisieren,
dass alles möglich sein kann. Und auch konzeptionell groß
zu denken, das Bild als eigenständiges künstlerisches Objekt zu verstehen
in der Technik der Druckgrafik. Auch das hängt sicher mit dem
Großformat zusammen. Als ich die Werkstatt übernommen habe, waren
die ersten Rückmeldungen, die Arbeiten seien sehr viel farbiger.
Ich selbst denke überhaupt nicht in Farbe. Es muss irgendwie passiert
sein …
Passieren Entdeckungen beim Arbeiten oder gibt es Funde von Materialien,
von denen ihr denkt, das könnte interessant sein?
Katja: Mir stellt sich immer die Frage, kann ich das drucken? Die klassische
Radierung arbeitet mit Metallplatten. Im experimentellen Bereich
verwenden wir auch Materialien wie Acrylplatten, Kartonagen,
also Pappen. Ronja kam irgendwann mit dem Wunsch nach großformatigem
Tetrapak. Jetzt haben wir es von der Rolle – dank ihrer Recherche.
Das alles zeige ich den Studierenden, und dann müssen sie
selbst ausprobieren, weil man nur dadurch lernt. Es ist spannend, Impulse
zu geben und zu schauen, wie sie sich dann verselbstständigen.
Ändern sich eure Motive mit einer anderen Technik, einem anderen
Material oder ist es umgekehrt?
Lilith: Ich habe zuerst viel mit Linoleum gearbeitet – auf alten Fußböden
aus der Uni. Auch mein „Hotel Kubat“ war ein Rest Fußboden,
2 m lang. Das war meine erste Serie „Lost Places“, die leerstehende
Gebäude in Berlin zeigt, die in einer Stadt, wo es keinen Wohnraum
gibt, verkommen. Da ging es mir absolut ums Motiv und weniger um
die Technik, um das Zeichnerische, was man durch den Linolschnitt
hat. Und jetzt gefällt es mir, die Motive – meine Wälder – so aufzulösen,
dass sie aus der Nähe nicht erkennbar sind. Weil man im Wald ja
auch nicht erkennt, dass man im Wald ist, erst wenn man ein bisschen
heraustritt. Bei meinen Tiefdrucken bin ich noch am Experimentieren
und habe Spaß daran, weil ich noch nicht an einem Punkt bin, wo ich
denke, dass da ein Konzept her muss. Die landschaftlichen Motive sind
melancholisch, sie haben für mich eine beruhigende Wirkung.
Ronja: Mich interessieren Nuancen von Farbe und Licht. Flüchtige urbane
Räume, stille menschenleere Szenerien und Landschaften, an
denen man aber eine Anwesenheit des Menschen spüren kann, ein
menschliches Eingreifen. So wie der Zaun in der Schneelandschaft von
„Zaungestöber“.
Diese Arbeit – auf der Rückseite des journals – ist auf Tetrapak, du arbeitest
auch auf eine Art Plastikfolie …
Ronja: … da fand ich es interessant, mit dem Dremel zu arbeiten. Man
zeichnet mit einem Bohrer, und je nachdem, was man für einen Aufsatz
einspannt, wird ein anderer Effekt erzeugt. Neulich habe ich auf
dem Flohmarkt ein altes Nagelpolierset gefunden, mit dessen Aufsätzen
kann man ganz weiche Schleifspuren erzeugen. Sie vermischen
sich dann auf der Materialebene. Mit Textilien habe ich auch viel gearbeitet,
aus dem Modedesignstudium und meiner Arbeit im Strickbereich
habe ich sie immer ein bisschen im Kopf. In der Schule führe
ich jetzt eine Druckwerkstatt AG und dafür sammle ich Stoffe, Reste
… Sie alle haben irgendwelche Strukturen und können einen Effekt
erzeugen. Ausprobieren macht Spaß: Für was könnte ein Material stehen,
was für eine Bildsprache kann es haben. Der Zaun ist so ein Überbleibsel
aus der Textilwerkstatt. Überall lässt sich irgendetwas finden.
Lisa: Bei mir sind es meistens Orte, die für mich absolut paradiesisch
waren, Sehnsuchtsorte. Ich versuche, sie aus dem Gedächtnis zu reproduzieren
und für mich zu überprüfen, wie verklärt die Erinnerung
daran ist und wie sehr sie sich verändert. In der Natur verändert sich
ständig alles, und so versuche ich, auch im Einfärbungsprozess immer
einem anderen Impuls nachzugehen, mit anderen Farben zu arbeiten.
Und ich möchte ein Rauschen erzeugen, deswegen ist alles so kleinteilig
dargestellt, sodass man fast das Wasser hören kann oder die Blätter
rascheln … („Vancouver Forest“, zu sehen auf dem Cover)
Lilith: Bei dir ist total interessant, was für eine Wirkung deine Arbeiten
haben, wenn sie farbig unterschiedlich gedruckt werden. Ich habe
das Gefühl, dass es durch die Farbveränderung auch eine andere zeitliche
Wahrnehmung gibt.
Ihr arbeitet zusammen, stellt zusammen aus, ihr kennt eure Arbeiten
und könnt sehr genau über eure Arbeitsweisen sprechen. Und ihr
schätzt einander. Das ist besonders, gerade in dieser Konstellation.
Lisa: Unsere Arbeitsweisen sind sehr unterschiedlich, sehr individuell,
passen aber gut zusammen. Ich traue mir viel mehr zu, wenn die beiden
dabei sind. Weil wir uns so gut ergänzen. Wir helfen einander bei
der Hängung oder bei der Organisation. Es ist einfach gut zu wissen,
dass man einen Rückhalt hat.
Ronja: Und wir beeinflussen uns natürlich gegenseitig. Eine Künstlerfreundschaft
im gleichen Medium hält ja nicht jeder aus. Für uns ist
das eine maximale Bereicherung.
Katja, du hast die Entwicklung der drei über die Jahre begleitet. Was
hast du beobachtet?
Katja: Lisa kommt aus dem Holzschneiden, es ist ein Spontan-Schneiden,
ein intuitives „Losknuspern“ im Material. Sie denkt mit dem
Hohleisen
in der Hand, auch bei den riesigen Platten. Beim Drucken
staune ich immer wieder, welche Farbkombinationen sie wählt.
Lisa: Ich habe mit einer 2-m-Schrankrückwand angefangen, einer
MDF-Platte, die ich gefunden habe. Darauf gibt es ja schon Strukturen,
und ich wollte ausprobieren und auf das Material eingehen.
Katja: MDF – ein schreckliches Material, aber Lisa hat mich überzeugt,
ich bin da offen. Man kann eben mit fast allen Materialien arbeiten,
mit geprägten Papieren, Tapeten, Resten von Dingen mit interessanten
Oberflächen.
Lilith: Lisa malt mit ihren Platten. Sehr intuitiv. Sie hat keine wirkliche
Vorzeichnung, nur ein paar Striche, das wars. Und es ist schon toll,
dass es einfach so im Moment passiert. Man sieht, dass sie Malerin ist.
Mir fällt es total schwer, verschiedene Farben zusammenzudenken,
deswegen ist es immer nur eine.
Hast du eine Vorstellung von deinem Bild, wenn du beginnst?
Lisa: Ich habe schon eine Idee, überlege mir dann, was im Hochdruck
hell ist und wie ich das so machen kann, dass es gleichzeitig als Zeichnung
im Tiefdruck funktioniert. Und so ergibt es sich dann. Es ist der
Hochdruck, der bestimmt, und den versuche ich im Tiefdruck gleichzeitig
mitzudenken.
Katja: Lilith hat angefangen mit ganz durchgeplanten Linolschnitten,
mit detailreichen Vorzeichnungen auf der Platte in schwarz/weiß – im
Schneiden mit einer gewissen Strenge, einem Raster in der Vorlage,
und mit einer enormen Geduld hat sie viele Stunden daran geschnitten.
Ein ganz anderer Ansatz. Ein Raster ist an sich schon ein druckgrafisches
Prinzip. In der Strenge des Rasters eine Freiheit und eine Abstraktion
zu entwickeln, das finde ich spannend. Das sieht man auch
in ihren letzten Arbeiten – man erkennt immer einen „echten Lilith“.
Lilith: Ich plane wirklich vom Beginn bis zum Ende. Ich kann nicht intuitiv
arbeiten. Es gibt kaum Zufall, er passiert dann erst beim Drucken,
bei der Platte eigentlich nicht. Am Ende kann es aber wirklich
ganz anders aussehen.
Der Zufall erschreckt dich? Weil er dir die Kontrolle entreißt?
Lilith: Am Anfang fand ich es richtig schwer, mich auf den Zufall einzulassen.
Gerade, wenn man ein Perfektionist ist. Katja sagt aber,
dass das Teil des Verfahrens ist. Mittlerweile kann ich einiges besser
einschätzen.
Ronja: Ich habe zum Beispiel im Skizzenbuch erst einmal meine Fotos
gemalt und danach angefangen zu schnitzen. Das sieht man den
Arbeiten an, weil sie malerischer werden, als wenn ich mich an einem
Foto orientiere.
Lisa: Ronja hat immer ein Konzept, auch ganz bestimmte Farben, und
sie arbeitet so lange daran, bis es so wird, wie sie es sich vorgestellt
hat. Es ist voll schön, dass jemand das so im Kopf hat. Man merkt,
dass sie vorher Modedesign gemacht hat. Das Konzeptionelle und
auch dieses Stoffliche. Und es gibt immer ein Tüpfelchen, eine kleine
Überraschung, etwas worüber man sich so richtig freut. Und bei Lilith
merkt man, dass sie aus dem Linolschnitt kommt. Bei ihr geht es viel
um Struktur und Schnitt, nicht so sehr um Farbe. Es ist wirklich krass,
wie lange sie an den Platten schneidet und wie genau. Von uns ist
sie wahrscheinlich am genauesten. Ich schneide ja meistens drauf los.
Manchmal versuche ich es auch mit einem Konzept, aber das verwerfe
ich sehr bald im Arbeitsprozess. Ganz nach Vorlage zu schneiden – da
hätte ich Angst vor – vor der Kontrolle.
Katja: Jeder findet seinen Weg. Ronja kam zum ersten Mal in die
Werkstatt mit einer Platte, einer Idee und einer Frage. Sie probiert
ganz viel aus, kombiniert Materialien, puzzelt ihre Druckplatten aus
mehreren Teilen zusammen, druckt mehrere Ebenen übereinander …
Ich finde es spannend, sich hineinzudenken in unterschiedliche Studierende
und ihre Ideen, die Herausforderung, sich etwas in den Kopf
zu setzen und dann zu schauen, wie man es hinbekommt, das Durchhaltevermögen
und am Experiment bleiben. Das Tolle an der Arbeit
hier ist, dass man am Morgen nicht weiß, was am Abend an den Wänden
zum Trocknen hängen wird.
Katja Wolf leitet die Werkstatt für Experimentelle Druckgrafik.
Lilith Nossol studiert Bildende Kunst (Lehramt) bei Prof. Karsten
Konrad, Lisa Faustmann bei Prof. Mark Lammert, Ronja Look
(Lehramt) bei Prof. Gregory Cumins.
katjawolf.net; @lilith_nossol; @faust_frau; @ronjalook
Werkstattbesuch und Text: Marina Dafova