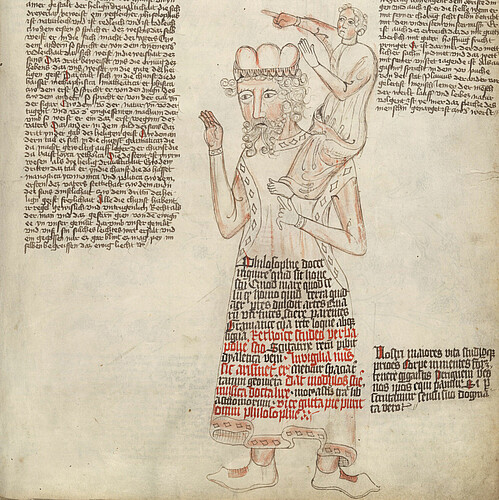Peccato! Von Seelendieben, Zwergen und Kamelen in Kunst und Architektur
Der plagiarius oder plagiator ist dem lateinischen Ursprung nach ein
Seelendieb, also Menschen- oder Sklavenhändler. Schon seit der Antike
aber verstehen wir im übertragenen Sinn unter dem Begriff zunehmend
jenen Dieb, der Ideen klaut und sich daran bereichert. Das Plagiat
bezeichnet das unrechtmäßig hergestellte Produkt dieses Diebstahls. Es
ist in erster Linie der verschleiernde Umgang mit der Urheberschaft, der
den Prozess und das Ergebnis zu einem amoralischen Konstrukt macht,
nicht so sehr die Tatsache des Aufgreifens oder Weiterverarbeitens der
Idee.
Vor nicht allzu langer Zeit hat der Kunsthistoriker Horst Bredekamp,
und wer wollte ihm widersprechen, im „Salon zum geistigen Eigentum“
zum Besten gegeben, in der Kunstgeschichte gebe es keine Plagiate,
denn alles in der Kunst sei Übernahme und Weiterentwicklung.
Das erinnert an Bernhard von Chartres, der im frühen 12. Jahrhundert
gesagt haben soll, wir seien Zwerge auf den Schultern von Riesen.
Quatremère de Quincy, der französische Architekturtheoretiker, hatte
das ähnlich ausgedrückt: „Il faut un antécédent à tout; rien en aucun
genre, ne vient de rien“ – alles hat einen Vorläufer, nichts kommt von
nichts. Für jede Leistung gibt es eine Vorstufe des Denkens und Handelns.
Nun bilden die von Bredekamp ins Feld geführten Mariendarstellungen
nicht unbedingt das Zentrum der Plagiatsdebatte in der Kunst
und sicherlich nicht deren dringlichstes Beispiel, aber es zeigt, dass von
der Gesellschaft seit Jahrhunderten festgelegte, kanonisierte Formeln
und Muster nicht unter das Thema der Verletzung geistigen Eigentums
fallen, da der Prozess der kollektiven Aneignung und Einigung, wer
auch immer im einzelnen Fall hier beteiligt gewesen sein mag, dieses
längst überschrieben hat. Aber tatsächlich entsteht die Verletzung
geistigen Eigentums ohnehin erst an der Stelle, wo ein allgemeines Bewusstsein
von individueller Autorenschaft gegeben ist. Der Autor aber,
so Roland Barthes, ist eine „moderne Figur“.
Nicht nur im Diebstahl ist das Konzept der Idee mit jenem der menschlichen
Seele verwandt. Es ist ihre Immaterialität und ihre zwangsläufige
Abspaltung vom Menschen, die sie vergleichbar macht. Zu Beginn
werden Seele/Idee und Mensch/Autor*in noch in irgendeiner Form von
Identität existieren, aber die beiden trennen sich unweigerlich voneinander.
Victor Hugo, einer der grundlegenden Denker des Urheberrechts
und zusammen mit anderen „Autor“ der Berner Übereinkunft
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst (1886) – und damit des
Konzepts moderner Autorschaft und der gesetzlichen Regelung von
Plagiatsvorgängen –, schrieb in seinem Roman „Notre-Dame de Paris“,
durch den Buchdruck würden den Ideen Flügel wachsen, sie würden
unsterblich. Der Autor mag tot sein, das Medium verloren, die Ideen
aber bleiben bestehen, sie fliegen umher. Und wo bleibt die Autorschaft?
Sie bleibt in der Mitte stecken.
Das Plagiat als Ideenklau selbst geschieht überwiegend willentlich, Plagiatoren
klauen und verschleiern bewusst. Ansonsten würden wir uns
über bemängelnde Irrtümer, handwerkliche Mängel, peinliche Unterlassungen
unterhalten, nicht aber über ernsthafte moralische Vergehen.
Es wären dann mistakes, nicht faults, oder peccati veniali (verzeihliche
Sünden), nicht aber peccati mortiferi (Todsünden), wie die
katholische Kirche unterscheidet. Plagiate sind „verlogen, erbärmlich
und klein“, um Sophie Hunger aus „Spaghetti mit Spinat“ wild zu zitieren.
Aber wie immer ist die Sache kompliziert, denn im Plagiat stecken
grundsätzlich Lüge und Verschleierung in all ihrer Varianz. Was ist
zum Beispiel mit Björn Höcke, der auf einer Wahlkampfveranstaltung
der AfD in Merseburg 2021 wörtlich sagte: „Alles für Deutschland“?
Angeblich habe er diesen unsäglichen Spruch der SA nicht gekannt,
als er ihn sagte, dieser sei also seine Erfindung. Vor Gericht bestritt der
ehemalige Geschichtslehrer, den wahren Ursprung, die Autorschaft des
Satzes gekannt zu haben, gleichzeitig wussten seine Zuhörer*innen es
besser. Höcke referenzierte und zitierte in die eine Richtung, leugnet
die Übernahme und plagiiert demnach in die andere. Ein janusköpfiger,
zwiespältiger Auftritt. Auch wenn der Fall atypisch ist, zeigt er sehr
gut, dass die Angelegenheit des Plagiierens sehr viel komplexer ist, als
man denkt. Eindeutig ist der doppelte Seelendiebstahl. Also noch einmal:
Nicht das Kopieren und Imitieren als Handlungsform macht das
Problem des Plagiats aus, sondern die Motivation der verschleiernden,
anmaßenden Verwertung.
Kunst und Architektur haben zudem keine Fußnoten, um so auf die
Herkunft von Ideen hinzuweisen, und solche Nachweise werden von
Kunst auch gar nicht erwartet. Im Regelfall wird davon ausgegangen,
dass die eine Hälfte der Betrachter*innen die Übernahme nicht weiter
bemerken wird, die andere hingegen eine Referenzierung als witziges,
ironisches oder auch bierernstes Zitat erkennen und feiern oder eben
ablehnen wird. „Doppelkodierung“ nannte Charles Jencks diese zweigleisige
Anlage des Werkes durch Architekt*innen und dessen Aufnahme
in unterschiedlich informierten Rezipient*innenkreisen. Kollision,
Fragmentierung, Überblendung sowie Weiterentwicklung von
Referenzen kulminieren in allerhand früher meistens als postmodern,
heute als erzählerisch titulierten Werken. Man diskutiert in Fachkreisen
eher die zugrunde liegenden Entwurfsstrategien oder den Umgang
mit der Geschichte, nicht so sehr die Rechtmäßigkeit der Zugriffsform.
So werden wir verkleinerte Nachbauten weltbekannter Bauwerke in
Themen- und Vergnügungsparks genauso wenig als Plagiate geißeln
wie einen kopierenden Umgang mit mehr oder weniger großen oder
zahlreichen Details zeitlich vorangegangener Entwürfe. Das mit dem
UNESCO-Welterbe-Status ausgezeichnete Hallstadt im österreichischen
Salzkammergut zum Beispiel wurde in Luoyangzhen in der südchinesischen
Provinz Guangdong 2012 (angeblich spiegelverkehrt) nachgebaut,
wo es sich nun wie gewünscht seinerseits zu einem Touristenmagnet
entwickelt hat. Ein Plagiatsverfahren gab es trotz des Gefühls der
Piraterie nicht – es wäre auch einigermaßen sinnlos gewesen. Denn anschließend
an das oben genannte Marienbild kann man auch für die
Architektur feststellen, dass bei typologischen Konstanten wie Grundund
Aufrissen von Kirchengebäuden, Raumtypen oder motivischen
Übernahmen, aber eben auch bei jahrhundertealten Bauten oder sogar
Straßenzügen niemand von Plagiaten reden wird. Es fehlen schlicht
und ergreifend die Autoren, um urheberrechtliche Fragen zu stellen.
Großartig und vollkommen sinnfrei setzte James Stirling im Berliner
Wissenschaftszentrum für Sozialforschung eine Kollision von europäischen
architektonischen Bautypen in Szene, Colin Rowe und Fred
Koetter schlugen in Collage City das Nebeneinander als städtebauliche
Leitlinie nach der „unerfreulichen Textur“ der Moderne vor. Einige
der damaligen Zauberlehrlinge, unter ihnen auch Hans Kollhoff, der
zusammen mit einem Mitstudenten für Rowe den Plan einer „City of
Composite Presence“ collagierte, versuchten dies auch räumlich umzusetzen.
Er hinterließ auf diese Weise eine der schönsten referenzierenden
Klebearbeiten der Berliner Architektur: Die Wohnanlage gegenüber
vom Neuen Pavillon schneidet Vorhandenes und neu Entworfenes
auseinander und bastelt alles zu einem Baukörper über einen Block
und zwei Brandwände hinweg wieder zusammen. Nebenbei werden
hier Bauten Le Corbusiers, Walter Gropius‘ und des näherliegenden
Karl Friedrich Schinkel zitiert. In der Folge bekam der Autor allerdings
Angst vor der eigenen Courage und flüchtete sich für die kommenden
Jahrzehnte in weniger luzide Historismen.
Echte Plagiatsfälle sind in der Architektur also eher selten. Immerhin
gab es 1996 in Berlin eine heftige Debatte um den Umbau des Reichstags.
Die Idee einer Kuppelrekonstruktion verstoße gegen seine Urheberrechte,
so vermutete damals Santiago Calatrava. Norman Foster,
der schlussendlich ausführende Architekt, hatte zunächst einen großen,
den gesamten Bau überspannenden Baldachin vorgesehen. Der
Auftraggeber, der Deutsche Bundestag, wünschte sich dann doch eine
Kuppel, und da Foster eine Rekonstruktion der ursprünglichen Situation
ablehnte, entschieden Baukommission und Abgeordnete die Ausführung
einer „modernen Interpretation der ursprünglichen Form“. Da
die Kuppel nun weder aussieht wie der zerstörte Vorgänger noch wie
der Entwurf Calatravas, ging es bei der Debatte um den Ideendiebstahl
also um die Idee einer Kuppel, nicht aber um die spezifische formale
Lösung. „What is a camel?“, so beginnt ein US-amerikanischer Witz,
„a camel is a horse designed by a committee!” Kamele gelten wohl
eher nicht als Urheberrechtsverletzung, auch wenn sie, verglichen mit
einem Pferd, seltsam aussehen mögen. Die Feststellung eines Plagiats
hat daher auch etwas mit der Methodik des Vergleichens zu tun.
Matthias Noell ist Professor für Architekturgeschichte und
Architekturtheorie am Institut für Architektur und Städtebau.
www.arch.udk-berlin.de