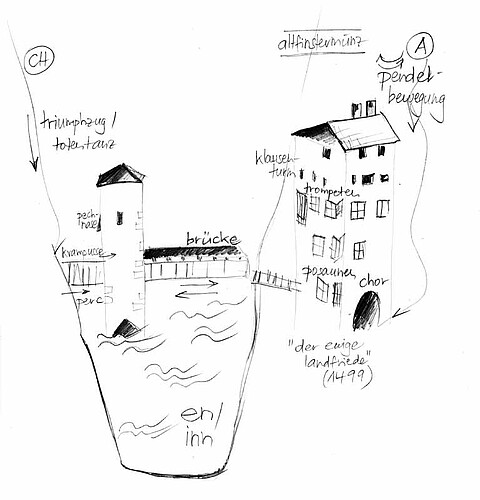Altfinstermünz. Im Schattental
Gibt es Schatten in der Musik?
Schatten, ist ja ein Begriff aus der bildenden Kunst und wird sofort
interessant, wenn man ihn als Metapher und Bild auch auf Töne anwendet.
Meine letzte Arbeit war Ende Juni in Altfinstermünz, einem
Grenzort, tief unten im Inntal zwischen Engadin und Tirol. Es war eine
gemeinsame Arbeit mit dem Regisseur Enrico Stolzenburg, eine
Landschaftskomposition, eine „Grenzüberschreitung“.
Das Tal dort ist sehr tief und die Sonne kommt nicht überall hin.
Daher gibt es im Hochsommer bei Tageslicht zwar verschiedene
Helligkeitszustände, aber so gut wie keinen Schatten,
und um 17.30 Uhr ist die Sonne weg.
Enrico Stolzenburg und ich haben den Lichteinfall im Tal beobachtet und
ausgerechnet, wie viel Licht und wie viel Schatten wann und wo vorhanden
ist. Davon ausgehend, habe ich komponiert.
War Schatten das Thema?
Nicht direkt, das Thema war der Ort: Altfinstermünz. Der Schatten,
das „Finstere“ ist schon im Namen angelegt. Lesbar auch als „finstere
Münze“, also Schwarzgeld. Hier muss viel geschmuggelt worden sein.
Altfinstermünz war bereits im späten Mittelalter eine Zollstation, bis
heute verläuft dort die Landesgrenze zwischen Österreich (Tirol) und
der Schweiz (Engadin), die Grenze zu Italien (Vinschgau) ist nur einen
Steinwurf entfernt. Uns hat diese Grenzsituation interessiert und die
Topographie der Inn-Schlucht. Ganz in der Nähe liegt ein weiteres,
tief eingeschnittenes Tal, das Bergell, wo vier Monate lang im Winter
keine Sonne hinkommt. Dort ist der Bildhauer Alberto Giacometti
aufgewachsen, seine langen, dünnen Figuren assoziiere ich immer mit
dieser Landschaft.
Wie kommt man auf die Idee, an einem solchen Ort zu inszenieren?
Der Anlass war ein Musiktheater-Festival zum 500sten Todestag von
Kaiser Maximilian: „Die sieben Leben des Maximilian“. Eine von sieben
„Volksopern“ für das Land Tirol, mit und für die Menschen, die
dort wohnen. Die Burg in Altfinstermünz war Kulisse und Haupt-Protagonist
unserer Klang-Aktion. Bei unserer ersten Begehung
von der Tiroler Seite aus waren wir sofort fasziniert von diesem Schattenloch.
Und dann war ich überrascht, dass hinter der verlassenen Brücke die
Schweiz beginnt. Als Schweizer kenne ich doch die Schweiz, dachte
ich, aber aus dieser Perspektive, von der Rückseite, habe ich sie noch
nie gesehen ...
Es ist ein düsterer Ort, eine vergessene Gegend, man hat das Gefühl,
die Welt ist hier zu Ende, egal von welchem Land aus man auf die
Grenze schaut. Auch historisch ist es interessant. Altfinstermünz lag
an der Via Claudia Augusta, einem alten römischen Hauptverkehrsweg
über die Alpen. Es war damals schon eine Zollstation, da ging
es auch um Wegrechte. Zur Zeit Maximilians war die Region Schauplatz
von kriegerischen Auseinandersetzungen. An dieser Stelle treffen
nicht nur Landesgrenzen aufeinander, sondern auch konfessionelle
Grenzen. Die Tiroler Seite ist sehr katholisch, die Engadiner
Seite sehr protestantisch. Und es ist eine Sprachgrenze. Der Nauderer
Dialekt auf der Habsburger Talseite ist auch für österreichische Ohren
ungewohnt. Am Schweizer Ufer wird Valader gesprochen, eine
rätoromanische Sprache, verwandt mit dem Rumänischen von weiter
flussabwärts.
Der Titel unserer Klang-Aktion ist auf Valader: „Fin al
cunfin“, was auf deutsch soviel heißt wie „hin zur Grenze“ oder „bis
zur Grenze“. Die Grenzen selbst sind heute offen.
Das ist eine sehr komplexe Situation, geografisch, politisch, kulturell
… eine interessante Schnittstelle mitten in Europa. Wie sieht es nun
heute am Ende der Welt aus?
Der ehemalige Bürgermeister von Nauders – auf der österreichischen
Seite – hat die Burg am Inn, also diese Zollstation, vor 20 Jahren wieder
aufgebaut. Und er hat sich mit dem Bürgermeister von Tschlin auf
der Schweizer Seite, und dem Bürgermeister von Reschen am Reschenpass
auf der italienischen Seite verbündet. Alle drei haben jahrelang
auch für grenzüberschreitende öffentliche Verkehrsverbindungen gekämpft.
Heute gibt es einmal pro Stunde eine Busverbindung aus jedem
der drei Länder zur Grenze und wieder zurück. Das Ganze hat
also auch eine soziale Dimension, die uns sehr interessiert hat.
Und wie entsteht eine Landschaftskomposition? Arbeitet man ausschließlich
dort?
Nein, nicht ganz, aber ich war sehr oft da, zusammen mit Enrico Stolzenburg.
Wir haben viele Tonaufnahmen gemacht, Lage-Skizzen gezeichnet,
um den Ort zu erforschen. Von Anfang an haben uns Musiker
aus Tschlin und Nauders begleitet, meistens mit Trompete oder
Posaune und verschiedene Orte akustisch getestet. Relativ rasch haben
wir eine Art Echo entdeckt, also eine Reflexion von Tönen. Wir
sind eben nicht nur direkt vom Licht ausgegangen, sondern haben
auch die Töne zu verschiedenen Tageszeiten ausprobiert und die klanglichen
Effekte studiert.
Eine Art akustisches Kartografieren und Vermessen des Ortes?
Ja, genau. Und das war doppelspurig angelegt. Die eine Spur ist die
akustische Forschung: Wie reagieren Klänge, wie reagieren welche Instrumente
wo. In erster Linie auf das Hören bezogen, aber auch natürlich
auf die Sichtbarkeit, auf das Licht. Wo gibt es Stellen, wo man
nur hört, aber nichts sieht. Und die andere Spur ist intuitiv – es geht
ja ums Komponieren und nicht um wissenschaftliche Forschung. Und
im Idealfall kommen Intuition und Klangforschung an einem Punkt
zusammen.
Wie sah nun die Inszenierung, die Volksoper aus?
Wir haben mit den Menschen aus den Dörfern der drei Länder gearbeitet,
mit Blaskapellen und Chören. Die Nachkommen derer, die
sich damals bekriegt haben, machen jetzt zusammen Musik. Es gab
zwei Aufführungen: Die erste fing in Österreich an und führte über
die Burg Altfinstermünz in die Schweiz. Zwei Stunden später dann
der umgekehrte Weg. Wir wollten eine Pendelbewegung inszenieren,
auch durch verschiedene Lichtsituationen. Und dann gab es einen
eher installativen Teil unten, in der Burg, mit sehr leisen instrumentalen
Klängen zu Tonaufnahmen vom Inn. Darüber habe ich noch
gar nicht nachgedacht, aber jetzt, wo wir darüber sprechen: Ja, natürlich,
der finstere Name assoziiert auch düstere Klänge. Die gewalttätige
Vergangenheit des Ortes sitzt noch in den Mauern, die Düsternis
ist zu spüren.
Was haben dann die Zuschauer dann gemacht?
Die Zuschauer haben die Komposition im Gehen gehört, und dabei
die Pendelbewegung der Musik nachgezeichnet: von Österreich in
die Schweiz und zurück. Die beteiligten Musikerinnen und Musiker
formierten sich zu einem Maximilianischen Triumphzug, der den Zuschauern
entgegenkam, und der sich aus der Nähe auf seiner Rückseite
als Totentanz entpuppte. Am Tag der Aufführung waren es 37
Grad, und alle haben den Schatten gesucht. Und den gab‘s nur auf der
Engadiner Talseite.
Musik und Komponieren hat für dich nicht nur mit Zeit, sondern sehr
viel mit Raum zu tun. Und dort gibt es Licht und Schatten.
Das stimmt. Es ist einfach die Frage, von welchem Musikbegriff ich
ausgehe. Wenn ich von einem eher traditionellen Musikbegriff ausgehe,
besteht Musik aus Klangfarbe, Tempo, Tonhöhe und Lautstärke.
Schatten kommen darin eher assoziativ vor, zum Beispiel als „Klangschatten“.
Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich der Musikbegriff stark
erweitert, zum Beispiel durch das Instrumentale Theater von John
Cage, Mauricio Kagel und Dieter Schnebel. Unter dem Stichwort „visible
music“ entstand u. a. Musik ausschließlich für die Augen. Das
Bewusstsein für den Raum, in welchem die Musik stattfindet, wurde
geschärft. Musik erhielt einen Körper. Für mich ist Musik immer eine
performative Kunst, hoch theatralisch, selbst wenn sie aus einem
Lautsprecher kommt.
Ich habe verschiedene Landschafts-Projekte mit Lichtwechsel komponiert,
Klang-Aktionen zum Sonnenuntergang oder zum Sonnenaufgang.
Zwielicht ist ein großes Thema in der Musik, der Übergang vom
Sichtbaren zum Unsichtbaren.
Daniel Ott ist Professor für Komposition und Experimentelles
Musiktheater und leitet Klangzeitort, Institut für Neue Musik Berlin,
ein Laboratorium für musikalische Komposition.
Das Gespräch führten Marina Dafova und Claudia Assmann.